Desperado des Lebens
Kleist, Potsdam, Preußen: Der Autor von "Michael Kohlhaas" war seiner Heimat in seltsamer Hassliebe verbunden. Warum seine Texte heute noch zu uns sprechen.
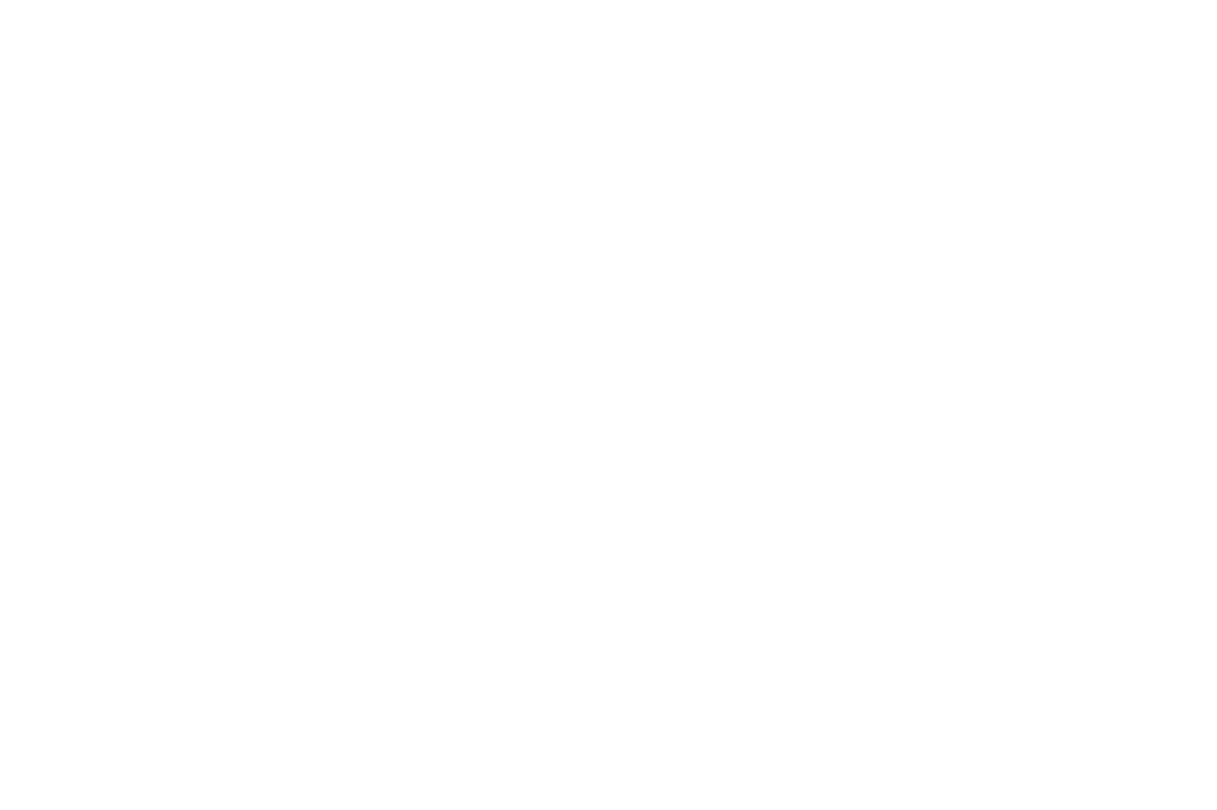
"Die Welt, das ganze Leben ist bei Kleist in einen Spannungszustand verwandelt": Szene aus "Michael Kohlhaas" (mit Kristin Muthwill)
Das Schicksal Heinrich von Kleists – fraglos einer der großen Autoren der Weltliteratur – ist eng mit der Stadt Potsdam verbunden, dem geistigen und politischen Zentrum Preußens. Seine Familie, ein altes Adelsgeschlecht, spielte in der preußischen Militärgeschichte eine bedeutende Rolle. Geboren 1777 in Frankfurt/Oder, wurde Kleist bereits im Alter von 14 Jahren in die Potsdamer Eliteeinheit Regiment Garde aufgenommen. Im Frühjahr 1799 trat er aus der Armee wieder aus – ein im Blick auf die Familientradition unerhörter Schritt. Es war riskant und ungewöhnlich, die gesicherte berufliche Existenz mit glänzenden Karriereaussichten aufs Spiel zu setzen, doch Kleist konnte nicht anders: der Soldatenstand erschien ihm als „Monument der Tyrannei“; er empfand bei dieser Lebensweise „etwas Ungleichartiges mit meinem ganzen Wesen“, wie es in einem seiner Briefe heißt.
Hier zeigt sich der Riss, der durch Kleists Dasein verläuft: Denn einerseits rang er beständig darum, sein Leben nach den Idealen Preußens auszurichten und Prinzipien wie Pflicht, Vernunft, Härte, Disziplin, Leistung, Ehrgeiz, Ordnung etc. zu entsprechen, um auf diese Weise die Anerkennung seiner Familie und der in Potsdam residierenden Elite zu erlangen. So unternahm er auch immer wieder Versuche, eine Laufbahn als preußischer Beamter anzutreten. Doch andererseits verspürte Kleist gleichzeitig eine solch starke innere Abwehr gegen diese Prinzipien und Lebensformen, dass er jedes Mal erneut die Flucht davor ergriff. Folglich war sein Leben von großer Rastlosigkeit geprägt. Zahlreiche Auf- und Abbrüche markieren den Weg seiner Biographie. Häufig begab er sich auf Reisen quer durch Europa und kehrte doch wie ein Süchtiger stets nach Preußen zurück, dem er in einer seltsamen Hassliebe verbunden blieb.
Im Jahre 1810 traf Kleist wieder einmal mit gescheiterten Projekten im Gepäck und finanziell abgebrannt in Berlin ein. Von den Spitzen des preußischen Staates und seiner Familie wurde er als Versager abgestempelt. Auch als Autor blieb ihm die Anerkennung verwehrt, die er so sehr ersehnte. So wählte er im November 1811 gemeinsam mit Henriette Vogel den Freitod und erschoss sich am Kleinen Wannsee bei Potsdam.
Der Schriftsteller Stefan Zweig nennt Kleist einen „Desperado des Lebens“ und spricht davon, dass „die Welt, das ganze Leben bei Kleist in einen Spannungszustand verwandelt“ sei. Von diesem Spannungszustand sind auch seine Texte geprägt, nicht zuletzt Michael Kohlhaas, dessen Heimatort Kohlhaasenbrück im Übrigen am Rande Potsdams liegt. Kleists literarischer Kosmos bezieht seine außergewöhnliche Kraft genau aus den Gegensätzen, die das Leben ihres Autors zu zerreißen drohen. Die besondere Qualität seiner Texte liegt im Zugleich des Widersprüchlichen: Gesetz und Exzess, Tugend und Maßlosigkeit, Rechtschaffenheit und Grausamkeit, Schmerz und Lust, Schönes und Schreckliches, Schmutz und Glanz, Krieg und Liebe – das alles ist hier untrennbar miteinander verbunden. Die Zerrissenheit Kleists vermittelt ein Bild von der höchst angefochtenen Stellung der Menschen in einer als unübersichtlich und widersprüchlich erfahrenen Wirklichkeit – ein Bild, mit dem wir uns heute vielleicht mehr denn je zu identifizieren vermögen.
Christopher Hanf
aus ZUGABE MAGAZIN 01-2022
Hier zeigt sich der Riss, der durch Kleists Dasein verläuft: Denn einerseits rang er beständig darum, sein Leben nach den Idealen Preußens auszurichten und Prinzipien wie Pflicht, Vernunft, Härte, Disziplin, Leistung, Ehrgeiz, Ordnung etc. zu entsprechen, um auf diese Weise die Anerkennung seiner Familie und der in Potsdam residierenden Elite zu erlangen. So unternahm er auch immer wieder Versuche, eine Laufbahn als preußischer Beamter anzutreten. Doch andererseits verspürte Kleist gleichzeitig eine solch starke innere Abwehr gegen diese Prinzipien und Lebensformen, dass er jedes Mal erneut die Flucht davor ergriff. Folglich war sein Leben von großer Rastlosigkeit geprägt. Zahlreiche Auf- und Abbrüche markieren den Weg seiner Biographie. Häufig begab er sich auf Reisen quer durch Europa und kehrte doch wie ein Süchtiger stets nach Preußen zurück, dem er in einer seltsamen Hassliebe verbunden blieb.
Im Jahre 1810 traf Kleist wieder einmal mit gescheiterten Projekten im Gepäck und finanziell abgebrannt in Berlin ein. Von den Spitzen des preußischen Staates und seiner Familie wurde er als Versager abgestempelt. Auch als Autor blieb ihm die Anerkennung verwehrt, die er so sehr ersehnte. So wählte er im November 1811 gemeinsam mit Henriette Vogel den Freitod und erschoss sich am Kleinen Wannsee bei Potsdam.
Der Schriftsteller Stefan Zweig nennt Kleist einen „Desperado des Lebens“ und spricht davon, dass „die Welt, das ganze Leben bei Kleist in einen Spannungszustand verwandelt“ sei. Von diesem Spannungszustand sind auch seine Texte geprägt, nicht zuletzt Michael Kohlhaas, dessen Heimatort Kohlhaasenbrück im Übrigen am Rande Potsdams liegt. Kleists literarischer Kosmos bezieht seine außergewöhnliche Kraft genau aus den Gegensätzen, die das Leben ihres Autors zu zerreißen drohen. Die besondere Qualität seiner Texte liegt im Zugleich des Widersprüchlichen: Gesetz und Exzess, Tugend und Maßlosigkeit, Rechtschaffenheit und Grausamkeit, Schmerz und Lust, Schönes und Schreckliches, Schmutz und Glanz, Krieg und Liebe – das alles ist hier untrennbar miteinander verbunden. Die Zerrissenheit Kleists vermittelt ein Bild von der höchst angefochtenen Stellung der Menschen in einer als unübersichtlich und widersprüchlich erfahrenen Wirklichkeit – ein Bild, mit dem wir uns heute vielleicht mehr denn je zu identifizieren vermögen.
Christopher Hanf
aus ZUGABE MAGAZIN 01-2022