„Eigentlich ist das alles pure Aktionskunst"
Die Regisseurin Petra Schönwald im Interview über ihre Inszenierung "So lonely“ und die Besonderheit, dass ein Junge offen seine Gefühle zeigt und diese nicht versteckt
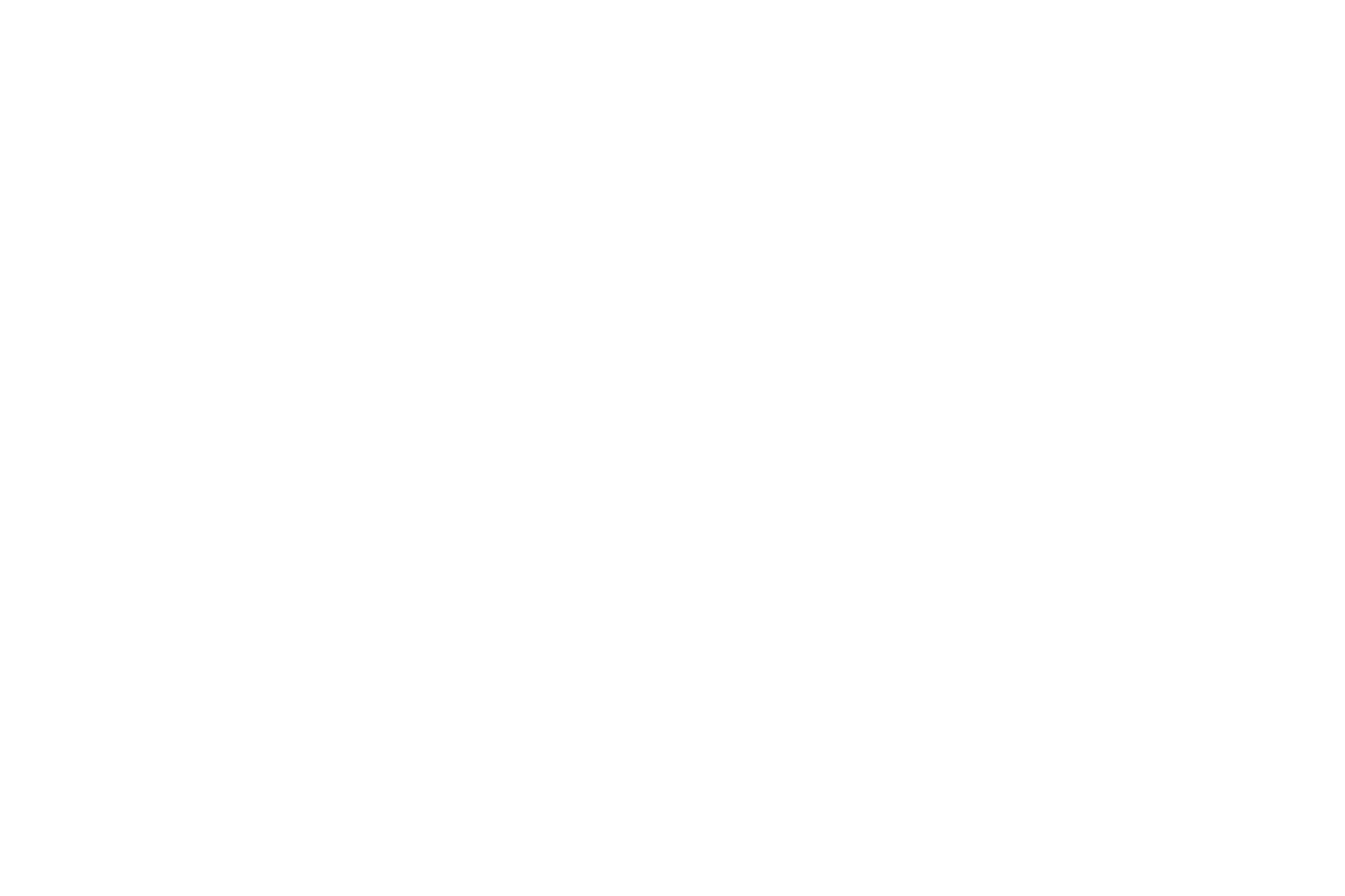
Petra Schönwald
Das Stück "So lonely" gewährt tiefe Einblicke in das Gefühlschaos der ersten Liebe. Inwieweit erinnerst du dich an diese (besondere) Zeit in deinem Leben?
Petra Schönwald: Es gab für mich damals nicht die Erfahrung einer ersten große Liebe in dem Sinn. Ich erinnere mich eher an eine fortlaufende Serie aus Hoffnungen und Enttäuschungen. Das wechselte sich manchmal sehr schnell ab, war ganz schön anstrengend und leider nie so romantisch wie ich mir das gemäß meiner Teeniefilm-Prägung erwartet hatte.
Die Bühne wird gewissermaßen zum Tatort / Erinnerungsraum, die Handlung nimmt kriminalistische Züge an. Wieso hast du dich gemeinsam mit der Bühnenbildnerin für dieses Setting entschieden?
Es geht uns in zweierlei Hinsicht um Beweisstücke. Der Junge sammelt seine Erinnerungen in plastischer Form und will diese materiellen Beweise an diesem Abend zerstören, eben weil er die Erinnerung – diesen „Film in seinem Kopf“, der ihm so viel Schmerz bereitet – endlich auslöschen möchte. In letzter Konsequenz plant er die Zerstörung seiner selbst, seinen möglichen Suizid. Er stellt sich vor, wie es wäre, wenn man ihn am nächsten Tag hier tot finden würde und wie das Mädchen bei seinem Begräbnis am Grab steht. Wir nahmen diesen Gedanken an Selbstmord von Anfang an ernst, nicht als reine Behauptung, sondern als reale Möglichkeit. Ebenso wie der Junge sich diesen Selbstmord vorstellt, haben wir uns überlegt wie dieser Raum retrospektiv gelesen werden würde, wenn es ein Tatort wäre. Die (zerstörten) Gegenstände wären Beweisstücke, ebenso wie sie jetzt in der aktuellen Handlung Beweisstücke dieser Erfahrung von großer Liebe und großem Schmerz sind.
Die Destruktion der Beweise bzw. Reliquien dient der Auslöschung des schmerzlich Erlebten. Setzt diese Zerstörung auch kreative Kräfte frei?
Ja auf alle Fälle! Zerstörung an sich hat etwas Lustvolles und Schöpferisches. Im Sinne der Autodestruktiven Kunst entsteht dadurch ja immer auch etwas Neues und Unvorhergesehenes. Ich sehe es in unserer Geschichte nicht als einfaches Kaputtmachen, sondern eher als eine Verwandlung eines Zustands in einen anderen, sowohl intern als auch extern. Der Junge hat ein sehr phantasievolles und elaboriertes System entwickelt, wie er diese Gegenstände zerstören möchte, was dann aber erst im Moment der echten Aktion bzw. Destruktion auf der Bühne wirklich stattfindet und durch die Interaktion zwischen Junge und Mädchen erst seine eigentliche Form erhält. Also eigentlich ist das alles pure Aktionskunst, wahrscheinlich Fluxus, würde ich mal sagen.
Gibt es aus deiner Sicht je nach Geschlecht bzw. geschlechtlicher Orientierung einen Unterschied im Umgang mit Liebeskummer?
Nein. Den Unterschied gibt es nur in unserem gesellschaftlich geprägten Verhalten, also was man von uns erwartet, was wir zeigen dürfen bzw. sollen. Da unterscheiden sich natürlich die Rollen. Das Besondere von „So lonely“ ist, dass hier ein Junge seine Gefühle offen zeigt, dass er seinen Kummer nicht versteckt oder kaschiert, sondern nachempfinden lässt, also ein gefühlsbetontes Verhalten, das als zutiefst „unmännlich“ gilt. Und toxische Ideen von Männlichkeit sind mitunter dafür verantwortlich, dass immer noch so viele Männer und Jungen ihren Kummer in sich hineinfressen, um „ihren Mann zu stehen“. Jack Urwin weist in seinem Buch „Boys don’t cry“ sehr überzeugend auf den Zusammenhang zwischen toxischer Männlichkeit und der viel höheren Selbstmordrate von Männern gegenüber Frauen hin: 78 % aller Suizide werden von Männern verübt und gerade bei jungen Männern zwischen 20 und 45 Jahren ist Selbstmord die Todesursache Nummer 1. Auch wenn das ganze Thema sehr komplex ist, muss man wohl angesichts dieser Zahlen von einem unterschiedlich sozialisierten Umgang mit Kummer und Schmerz ausgehen. Hier haben Frauen wohl einen der wenigen Vorteile innerhalb der patriarchalen Gesellschaft: Sie dürfen immer und überall weinen (weil sie sowieso nicht ernst genommen werden), und das befreit nun mal auch.
Du bedienst dich auch ganz bewusst filmischer Mittel. Warum?
Der Junge spricht auch schon in der Romanvorlage häufig von „seinem Film“, also von seiner Erinnerung an die Zeit mit Ann-Katrin, die sich immer wieder in seinem Kopf abspult. Im Unterschied zum Roman wollte ich aber die Begegnungen der beiden auf der Bühne real werden lassen und nicht in filmischen Rückblenden erzählen. Das Filmische ist in unserer Version Teil seiner eigenen Inszenierung dieses Abends. Er dreht einen Film gegen den Film (im Kopf): die Zerstörung der Dinge (und am Ende seiner selbst) soll filmisch dokumentiert und demonstriert werden. Die Bühne ist damit gewissermaßen auch sein Set. Diese (Selbst-) Inszenierung mit Kamera wirkt gerade aus heutiger Sicht sehr schlüssig, in Zeiten von Videochats, Insta und Youtube-Tutorials ist sie mittlerweile Bestandteil unserer modernen Alltagskultur und die Aufnahmefunktion macht auch vor Selbstmord nicht halt, im Gegenteil. Alles wird filmisch zelebriert und vielleicht sogar erst über das Auge der Kamera bewusster wahrgenommen. Das ist nicht so dystopisch gemeint wie es klingt, aber gruselig finde ich das schon manchmal.
Inwieweit sind der Junge und Ann-Katrin Projektionsfläche für den anderen? Befinden sich die beiden jeweils im „falschen Film“?
Das Stück wird zunächst aus der Perspektive des Jungen aufgerollt. Seine Erinnerungen an das Erlebte sind aber für uns nur eine Version der Geschichte und darin unterscheidet sich unsere Theaterfassung wohl am stärksten vom ursprünglichen Roman. Bereits durch das reale Auftreten Ann-Katrins verändert sich die Geschichte. Das Mädchen dient hier nicht als Projektionsfläche, sie hat ihre eigene Dynamik und ihr eigenes Erleben der Situation, was wir gleichwertig neben der Perspektive des Jungen zeigen wollen. Es ist wahrscheinlich unmöglich, sich keine Vorstellungen über sein Gegenüber zu machen. Den „richtigen Film“ gibt es vielleicht gar nicht. Aber die Bereitschaft, sich auf den Blickwinkel des anderen einzulassen, wäre die erste Voraussetzung für mehr Augenhöhe im Umgang miteinander. Das erspart nicht alle Schmerzen, aber schützt etwas vor zweidimensionalen Illusionen.
Petra Schönwald: Es gab für mich damals nicht die Erfahrung einer ersten große Liebe in dem Sinn. Ich erinnere mich eher an eine fortlaufende Serie aus Hoffnungen und Enttäuschungen. Das wechselte sich manchmal sehr schnell ab, war ganz schön anstrengend und leider nie so romantisch wie ich mir das gemäß meiner Teeniefilm-Prägung erwartet hatte.
Die Bühne wird gewissermaßen zum Tatort / Erinnerungsraum, die Handlung nimmt kriminalistische Züge an. Wieso hast du dich gemeinsam mit der Bühnenbildnerin für dieses Setting entschieden?
Es geht uns in zweierlei Hinsicht um Beweisstücke. Der Junge sammelt seine Erinnerungen in plastischer Form und will diese materiellen Beweise an diesem Abend zerstören, eben weil er die Erinnerung – diesen „Film in seinem Kopf“, der ihm so viel Schmerz bereitet – endlich auslöschen möchte. In letzter Konsequenz plant er die Zerstörung seiner selbst, seinen möglichen Suizid. Er stellt sich vor, wie es wäre, wenn man ihn am nächsten Tag hier tot finden würde und wie das Mädchen bei seinem Begräbnis am Grab steht. Wir nahmen diesen Gedanken an Selbstmord von Anfang an ernst, nicht als reine Behauptung, sondern als reale Möglichkeit. Ebenso wie der Junge sich diesen Selbstmord vorstellt, haben wir uns überlegt wie dieser Raum retrospektiv gelesen werden würde, wenn es ein Tatort wäre. Die (zerstörten) Gegenstände wären Beweisstücke, ebenso wie sie jetzt in der aktuellen Handlung Beweisstücke dieser Erfahrung von großer Liebe und großem Schmerz sind.
Die Destruktion der Beweise bzw. Reliquien dient der Auslöschung des schmerzlich Erlebten. Setzt diese Zerstörung auch kreative Kräfte frei?
Ja auf alle Fälle! Zerstörung an sich hat etwas Lustvolles und Schöpferisches. Im Sinne der Autodestruktiven Kunst entsteht dadurch ja immer auch etwas Neues und Unvorhergesehenes. Ich sehe es in unserer Geschichte nicht als einfaches Kaputtmachen, sondern eher als eine Verwandlung eines Zustands in einen anderen, sowohl intern als auch extern. Der Junge hat ein sehr phantasievolles und elaboriertes System entwickelt, wie er diese Gegenstände zerstören möchte, was dann aber erst im Moment der echten Aktion bzw. Destruktion auf der Bühne wirklich stattfindet und durch die Interaktion zwischen Junge und Mädchen erst seine eigentliche Form erhält. Also eigentlich ist das alles pure Aktionskunst, wahrscheinlich Fluxus, würde ich mal sagen.
Gibt es aus deiner Sicht je nach Geschlecht bzw. geschlechtlicher Orientierung einen Unterschied im Umgang mit Liebeskummer?
Nein. Den Unterschied gibt es nur in unserem gesellschaftlich geprägten Verhalten, also was man von uns erwartet, was wir zeigen dürfen bzw. sollen. Da unterscheiden sich natürlich die Rollen. Das Besondere von „So lonely“ ist, dass hier ein Junge seine Gefühle offen zeigt, dass er seinen Kummer nicht versteckt oder kaschiert, sondern nachempfinden lässt, also ein gefühlsbetontes Verhalten, das als zutiefst „unmännlich“ gilt. Und toxische Ideen von Männlichkeit sind mitunter dafür verantwortlich, dass immer noch so viele Männer und Jungen ihren Kummer in sich hineinfressen, um „ihren Mann zu stehen“. Jack Urwin weist in seinem Buch „Boys don’t cry“ sehr überzeugend auf den Zusammenhang zwischen toxischer Männlichkeit und der viel höheren Selbstmordrate von Männern gegenüber Frauen hin: 78 % aller Suizide werden von Männern verübt und gerade bei jungen Männern zwischen 20 und 45 Jahren ist Selbstmord die Todesursache Nummer 1. Auch wenn das ganze Thema sehr komplex ist, muss man wohl angesichts dieser Zahlen von einem unterschiedlich sozialisierten Umgang mit Kummer und Schmerz ausgehen. Hier haben Frauen wohl einen der wenigen Vorteile innerhalb der patriarchalen Gesellschaft: Sie dürfen immer und überall weinen (weil sie sowieso nicht ernst genommen werden), und das befreit nun mal auch.
Du bedienst dich auch ganz bewusst filmischer Mittel. Warum?
Der Junge spricht auch schon in der Romanvorlage häufig von „seinem Film“, also von seiner Erinnerung an die Zeit mit Ann-Katrin, die sich immer wieder in seinem Kopf abspult. Im Unterschied zum Roman wollte ich aber die Begegnungen der beiden auf der Bühne real werden lassen und nicht in filmischen Rückblenden erzählen. Das Filmische ist in unserer Version Teil seiner eigenen Inszenierung dieses Abends. Er dreht einen Film gegen den Film (im Kopf): die Zerstörung der Dinge (und am Ende seiner selbst) soll filmisch dokumentiert und demonstriert werden. Die Bühne ist damit gewissermaßen auch sein Set. Diese (Selbst-) Inszenierung mit Kamera wirkt gerade aus heutiger Sicht sehr schlüssig, in Zeiten von Videochats, Insta und Youtube-Tutorials ist sie mittlerweile Bestandteil unserer modernen Alltagskultur und die Aufnahmefunktion macht auch vor Selbstmord nicht halt, im Gegenteil. Alles wird filmisch zelebriert und vielleicht sogar erst über das Auge der Kamera bewusster wahrgenommen. Das ist nicht so dystopisch gemeint wie es klingt, aber gruselig finde ich das schon manchmal.
Inwieweit sind der Junge und Ann-Katrin Projektionsfläche für den anderen? Befinden sich die beiden jeweils im „falschen Film“?
Das Stück wird zunächst aus der Perspektive des Jungen aufgerollt. Seine Erinnerungen an das Erlebte sind aber für uns nur eine Version der Geschichte und darin unterscheidet sich unsere Theaterfassung wohl am stärksten vom ursprünglichen Roman. Bereits durch das reale Auftreten Ann-Katrins verändert sich die Geschichte. Das Mädchen dient hier nicht als Projektionsfläche, sie hat ihre eigene Dynamik und ihr eigenes Erleben der Situation, was wir gleichwertig neben der Perspektive des Jungen zeigen wollen. Es ist wahrscheinlich unmöglich, sich keine Vorstellungen über sein Gegenüber zu machen. Den „richtigen Film“ gibt es vielleicht gar nicht. Aber die Bereitschaft, sich auf den Blickwinkel des anderen einzulassen, wäre die erste Voraussetzung für mehr Augenhöhe im Umgang miteinander. Das erspart nicht alle Schmerzen, aber schützt etwas vor zweidimensionalen Illusionen.