„Vielleicht ist Godot längst da“
Die Regisseurin Fanny Brunner über "Warten auf Godot" von Samuel Beckett, absurdes Theater und Männer, die die Welt bedeuten
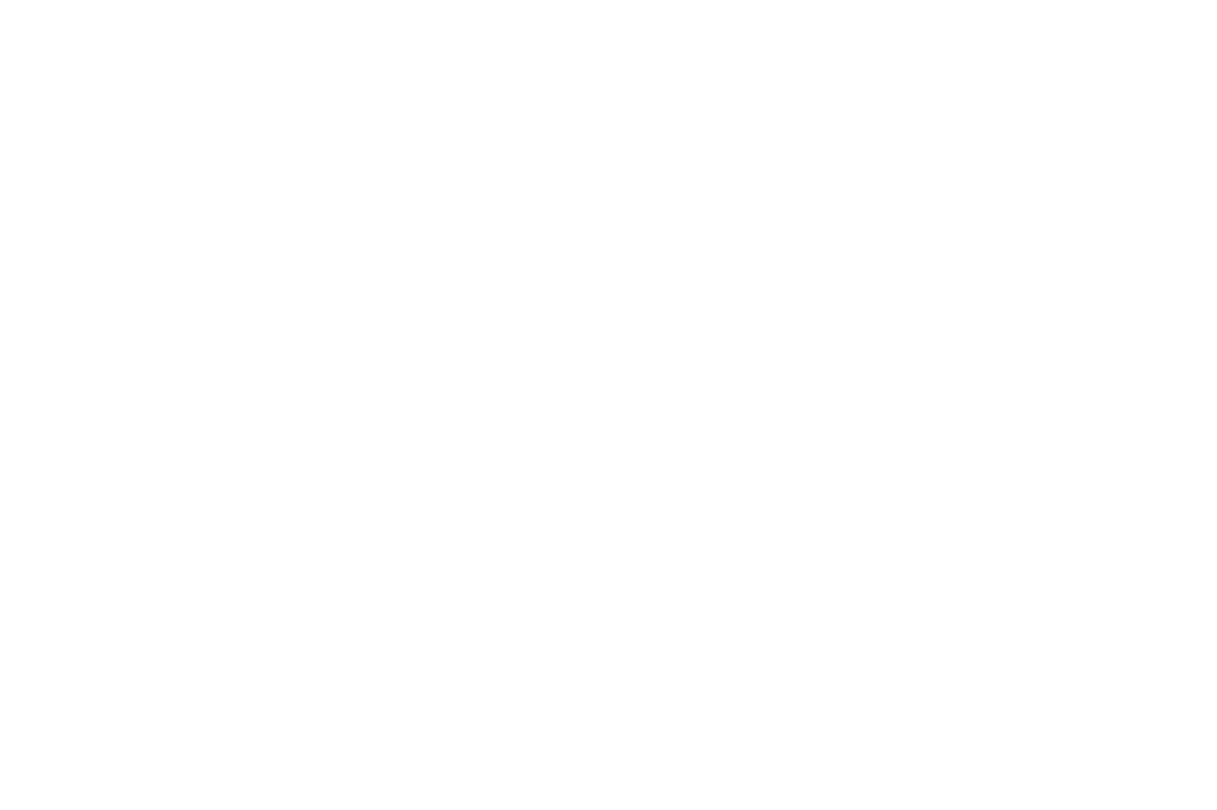
„Ja, wo sind hier die Frauen hin?“ – Henning Strübbe und Jon-Kaare Koppe als Estragon und Wladimir
Das Stück entstand 1948/49. Beckett verarbeitet darin eigene Erfahrungen, wie die Flucht mit seiner Gefährtin aus Paris während der deutschen Besatzung Frankreichs, das Leben in der Abgeschiedenheit eines südfranzösischen Bergdorfes und das Warten auf das Ende des Krieges, Hunger und Armut sowie das Warten auf Anerkennung als Schriftsteller. Was bedeutet Warten heutzutage?
Fanny Brunner: Warten assoziiere ich gegenwärtig mit versäumen, nicht mitbekommen, verpassen, übersehen. Handeln ist heute das Gebot der Stunde. Wladimir und Estragon stecken damals wie jetzt in einer Falle.
Die Warte-Situation der beiden Protagonisten lässt sich nicht klar und konkret an einer Zeit festmachen, eher sind sie zur Unzeit am Unort. Stehen sie außerhalb von Raum und Zeit?
Brunner: Das kommt auf die Perspektive an. Die Figuren selbst haben nicht das Bewusstsein, zur Unzeit an einem Unort zu sein. Für sie ist die Situation existenziell, weil ausweglos. Sie sind Aus-der-Zeit-Gefallene, die mitten im Hier und Jetzt hocken.
Ihr Handeln ist das Warten, es verdammt sie zur Passivität. Ist „Warten auf Godot“ ein Stück ohne Handlung?
Brunner: Wenn man das Warten auch als Handlungsakt begreift, dann handeln die Figuren sogar intensiv. Und plötzlich wird das Stück politisch. Ihr Verhalten ist ganz schön passiv-aggressiv. Wladimir und Estragon vertreiben sich die Langeweile mit Hutwechselspielchen und philosophischen Disputen.
Sie wissen nicht mehr, was gestern war. Nur das Jetzt wird erlebt. Die Protagonisten verlieren ihr Zeitgefühl – und das Publikum?
Brunner: Sobald ein sinnstiftendes Tätigsein abhandenkommt, zerfällt unser Zeitgefühl, wir sinken in Teilnahmslosigkeit und Resignation. Ein Tag in „Warten auf Godot“ ist ja hauptsächlich fokussiert auf den ihn beschließenden Sonnenuntergang und nicht auf eine mögliche Revolte oder den vehementen Wunsch, aus dieser Rahmung auszubrechen.
Ist es ein Theaterstück über verlorene Zeit, über das Menschsein ohne Perspektive?
Brunner: Es ist das Theaterstück eines Schriftstellers, der mithilfe mehrerer ausschließlich männlicher Charaktere über die menschliche Existenz nachdenkt. Das ist zumindest meine Wahrnehmung des Textes.
Die beiden Hauptfiguren machen ihre Hoffnung auf ein etwas menschlicheres Leben an Godot fest. Aber der Name bleibt nur eine Worthülse. Zweimal erscheint ein Junge als Bote von Godot. Wer oder was ist Godot?
Brunner: Godot ist das, was man draus macht. Godot ist eine Projektionsfläche für eigene Wünsche und Verfehlungen. Godot ist fantastisch. Vielleicht ist Godot auch längst da und wird nur nicht erkannt.
Neben Wladimir und Estragon zeigt Beckett ein zweites Männer-Duo: Pozzo und Lucky, die in einem brutalen Machtverhältnis zueinander stehen und trotzdem zusammenbleiben. Wie lässt sich diese Abhängigkeit erklären?
Brunner: Hegel erforschte die Interdependenz von Herr- und Knechtschaft. Sie besagt, dass der Knecht zwar Knecht ist kraft seiner erzwungenen Unterordnung, jedoch der Status des Herrn auch von der Anerkennung seiner Herrschaft durch den Knecht abhängig ist. In diesem Sinne führen Lucky und Pozzo eine hegelianische Idealbeziehung. Aber dieses scheinbar perfekte Verhältnis ist nur im Lot innerhalb eines Machtvakuums, in dem die sozialen Verhältnisse als Fügung des Schicksals hingenommen und gesellschaftlich toleriert werden.
Tragen Pozzo und Lucky trotz ihres menschenverachtenden Verhältnisses zur Unterhaltung bei?
Brunner: Ja, klar. Und diesen Widerspruch müssen wir aushalten. Unser Lachen zeigt, dass wir die Situation prinzipiell kennen. Die künstlerische Überhöhung von Realität ermöglicht uns, die Struktur darunter besser zu erkennen.
Sind Becketts Figuren überhaupt realistische Figuren oder Stereotypen aus der Welt der Clowns?
Brunner: Gegenfrage: Sind Politiker*innen realistische Figuren oder Stereotypen aus der Welt der Clowns? Ich glaube, der Unterschied ist nicht sehr groß. So funktioniert absurdes Theater.
Was ist damit gemeint?
Brunner: Von absurdem Theater spricht man, wenn die Dinge vermeintlich nicht zusammenpassen. Zeiten, Orte, Rollenfächer und Genres – alles wird vermischt. Wie im richtigen Leben. Wladimir und Estragon äußern mehrmals die Absicht, sich aufzuhängen. Dabei entsteht eine bedrohliche, zugleich merkwürdig komische Situation.
Wie ernst zu nehmen sind diese Andeutungen?
Brunner: Zwei Schauspieler spielen Theater, und dieses Theater eröffnet Möglichkeits- und Denkräume. Das darf man schon ernst nehmen.
Welche Bedeutung hat die Natur in der Gedankenwelt der Protagonisten?
Brunner: Gute Frage. Ich glaube, die Natur spielt keine maßgebliche Rolle, außer der, dass der Mensch ihr zu trotzen hat. Becketts Figuren sind ihr ausgeliefert, da sie kein Dach über dem Kopf haben. Sie betrachten sie ab und zu, wissen aber wenig mit ihr anzufangen. Becketts Figurenwelt ist männlich, darauf legte der Autor Wert.
An welchen Momenten könnte ein weiblicher Blick in der Inszenierung Akzente setzen?
Brunner: Ja, wo sind hier die Frauen hin? Das frage ich mich schon. Es gibt offenbar keine mehr. Sie sind der Welt abhandengekommen. Das Stück ist identitätspolitisch hoch interessant. Wir sehen Männer, die die Welt bedeuten. Wir sehen Männer, die für die Menschheit stehen. Wir sehen offenbar gescheiterte „alte weiße Männer“. Aber was ist denn ein Mann? Was macht ihn aus? Die Chromosomen? Seine spezifische Erfahrungswelt? Sein Machtanspruch? Die eindeutige Geschlechtszuordnung im Pass? Wenn diese alten weißen Männer über das Leben nachdenken, dann ist das natürlich spannend, hat das eine philosophische Dimension. Und gleichzeitig ist es hochgradig selbstreferenziell. Wir sehen ein Symbol, eine Idee, ein Modell, das geradezu omnipotent ausschließlich auf sich selbst Bezug nimmt. Aus der Beobachtung dieser Zuspitzung können wir vielleicht lernen, die uns umgebenden Verhältnisse in ihrer oft behaupteten Unumstößlichkeit besser zu durchschauen und infragezustellen.
Interview: Carola Gerbert
erschienen in ZUGABE 02-2023
Fanny Brunner: Warten assoziiere ich gegenwärtig mit versäumen, nicht mitbekommen, verpassen, übersehen. Handeln ist heute das Gebot der Stunde. Wladimir und Estragon stecken damals wie jetzt in einer Falle.
Die Warte-Situation der beiden Protagonisten lässt sich nicht klar und konkret an einer Zeit festmachen, eher sind sie zur Unzeit am Unort. Stehen sie außerhalb von Raum und Zeit?
Brunner: Das kommt auf die Perspektive an. Die Figuren selbst haben nicht das Bewusstsein, zur Unzeit an einem Unort zu sein. Für sie ist die Situation existenziell, weil ausweglos. Sie sind Aus-der-Zeit-Gefallene, die mitten im Hier und Jetzt hocken.
Ihr Handeln ist das Warten, es verdammt sie zur Passivität. Ist „Warten auf Godot“ ein Stück ohne Handlung?
Brunner: Wenn man das Warten auch als Handlungsakt begreift, dann handeln die Figuren sogar intensiv. Und plötzlich wird das Stück politisch. Ihr Verhalten ist ganz schön passiv-aggressiv. Wladimir und Estragon vertreiben sich die Langeweile mit Hutwechselspielchen und philosophischen Disputen.
Sie wissen nicht mehr, was gestern war. Nur das Jetzt wird erlebt. Die Protagonisten verlieren ihr Zeitgefühl – und das Publikum?
Brunner: Sobald ein sinnstiftendes Tätigsein abhandenkommt, zerfällt unser Zeitgefühl, wir sinken in Teilnahmslosigkeit und Resignation. Ein Tag in „Warten auf Godot“ ist ja hauptsächlich fokussiert auf den ihn beschließenden Sonnenuntergang und nicht auf eine mögliche Revolte oder den vehementen Wunsch, aus dieser Rahmung auszubrechen.
Ist es ein Theaterstück über verlorene Zeit, über das Menschsein ohne Perspektive?
Brunner: Es ist das Theaterstück eines Schriftstellers, der mithilfe mehrerer ausschließlich männlicher Charaktere über die menschliche Existenz nachdenkt. Das ist zumindest meine Wahrnehmung des Textes.
Die beiden Hauptfiguren machen ihre Hoffnung auf ein etwas menschlicheres Leben an Godot fest. Aber der Name bleibt nur eine Worthülse. Zweimal erscheint ein Junge als Bote von Godot. Wer oder was ist Godot?
Brunner: Godot ist das, was man draus macht. Godot ist eine Projektionsfläche für eigene Wünsche und Verfehlungen. Godot ist fantastisch. Vielleicht ist Godot auch längst da und wird nur nicht erkannt.
Neben Wladimir und Estragon zeigt Beckett ein zweites Männer-Duo: Pozzo und Lucky, die in einem brutalen Machtverhältnis zueinander stehen und trotzdem zusammenbleiben. Wie lässt sich diese Abhängigkeit erklären?
Brunner: Hegel erforschte die Interdependenz von Herr- und Knechtschaft. Sie besagt, dass der Knecht zwar Knecht ist kraft seiner erzwungenen Unterordnung, jedoch der Status des Herrn auch von der Anerkennung seiner Herrschaft durch den Knecht abhängig ist. In diesem Sinne führen Lucky und Pozzo eine hegelianische Idealbeziehung. Aber dieses scheinbar perfekte Verhältnis ist nur im Lot innerhalb eines Machtvakuums, in dem die sozialen Verhältnisse als Fügung des Schicksals hingenommen und gesellschaftlich toleriert werden.
Tragen Pozzo und Lucky trotz ihres menschenverachtenden Verhältnisses zur Unterhaltung bei?
Brunner: Ja, klar. Und diesen Widerspruch müssen wir aushalten. Unser Lachen zeigt, dass wir die Situation prinzipiell kennen. Die künstlerische Überhöhung von Realität ermöglicht uns, die Struktur darunter besser zu erkennen.
Sind Becketts Figuren überhaupt realistische Figuren oder Stereotypen aus der Welt der Clowns?
Brunner: Gegenfrage: Sind Politiker*innen realistische Figuren oder Stereotypen aus der Welt der Clowns? Ich glaube, der Unterschied ist nicht sehr groß. So funktioniert absurdes Theater.
Was ist damit gemeint?
Brunner: Von absurdem Theater spricht man, wenn die Dinge vermeintlich nicht zusammenpassen. Zeiten, Orte, Rollenfächer und Genres – alles wird vermischt. Wie im richtigen Leben. Wladimir und Estragon äußern mehrmals die Absicht, sich aufzuhängen. Dabei entsteht eine bedrohliche, zugleich merkwürdig komische Situation.
Wie ernst zu nehmen sind diese Andeutungen?
Brunner: Zwei Schauspieler spielen Theater, und dieses Theater eröffnet Möglichkeits- und Denkräume. Das darf man schon ernst nehmen.
Welche Bedeutung hat die Natur in der Gedankenwelt der Protagonisten?
Brunner: Gute Frage. Ich glaube, die Natur spielt keine maßgebliche Rolle, außer der, dass der Mensch ihr zu trotzen hat. Becketts Figuren sind ihr ausgeliefert, da sie kein Dach über dem Kopf haben. Sie betrachten sie ab und zu, wissen aber wenig mit ihr anzufangen. Becketts Figurenwelt ist männlich, darauf legte der Autor Wert.
An welchen Momenten könnte ein weiblicher Blick in der Inszenierung Akzente setzen?
Brunner: Ja, wo sind hier die Frauen hin? Das frage ich mich schon. Es gibt offenbar keine mehr. Sie sind der Welt abhandengekommen. Das Stück ist identitätspolitisch hoch interessant. Wir sehen Männer, die die Welt bedeuten. Wir sehen Männer, die für die Menschheit stehen. Wir sehen offenbar gescheiterte „alte weiße Männer“. Aber was ist denn ein Mann? Was macht ihn aus? Die Chromosomen? Seine spezifische Erfahrungswelt? Sein Machtanspruch? Die eindeutige Geschlechtszuordnung im Pass? Wenn diese alten weißen Männer über das Leben nachdenken, dann ist das natürlich spannend, hat das eine philosophische Dimension. Und gleichzeitig ist es hochgradig selbstreferenziell. Wir sehen ein Symbol, eine Idee, ein Modell, das geradezu omnipotent ausschließlich auf sich selbst Bezug nimmt. Aus der Beobachtung dieser Zuspitzung können wir vielleicht lernen, die uns umgebenden Verhältnisse in ihrer oft behaupteten Unumstößlichkeit besser zu durchschauen und infragezustellen.
Interview: Carola Gerbert
erschienen in ZUGABE 02-2023
„Der Zustand der Geschlechter ist verheerend“
Essayistin Ria Endres im Gespräch mit Ronald Pohl über Samuel Becketts Welt der Moribunden
Der Standard: Als Tenor tönt durch die umfangreiche Beckett-Literatur seit 30, 40 Jahren ein Warnruf: Auch wenn "Warten auf Godot" ein Gassenhauer geworden ist – dieser Autor macht es euch nicht leicht! Hat sich daran etwas geändert?
Ria Endres: Schon vor rund 20 Jahren, aber auch früher, hing Becketts Ruhm am Theater. Die frühe Prosa, die Romantrilogie von Molloy, Malone stirbt und Der Namenlose, ganz zu schweigen vom Spätwerk – das war immer Literatur für wenige. Nehmen Sie Arbeiten wie Mal vu, mal dit: wunderbar gemachte Ausgaben bei Suhrkamp. Großartig übersetzt, dreisprachig, eine einzigartige Unternehmung in der Literatur der Welt! Das kommt meiner Vorstellung von literarischem Luxus sehr nahe.
Schon weil Beckett selbst zweisprachig war. Fast dreisprachig, weil er sehr gut Deutsch konnte und die Übersetzungen von Elmar Tophoven exaktest durchgesehen hat. Er hat ja obendrein seine Texte zurückübersetzt, vom Französischen ins Englische, und so weiter. Diese Präsentation des Spätwerks war für Leute, die zu lesen verstehen, ungeheuer bereichernd. Diese Chiffren der Welt, des Subjekts, wohin man kommt, wenn man im kosmischen Endspielzimmer sitzt, das konnte auf sehr beeindruckende Weise nachvollzogen werden.
Der Standard: Aber Beckett hatte doch seine theologischen Mucken. Im "Namenlosen" sitzt ein Kopf auf einer Urne und wird von Stimmen gehetzt. Der Stimme im Kopf entkommt der Mensch nicht. Aber das‑ geschundene Subjekt des Textes steuert auf ein Schweigen zu, das das "wahre" Schweigen wäre. Dergleichen gibt doch Rätsel auf?
Ria Endres: Ich glaube, darüber kann man nicht reden. Da würden wir noch in zehn Jahren dasitzen. Das ist ja das Verführerische und zugleich Komplizierte. Nehmen Sie irgendein Phänomen her: das "Ende", das "Glück", das "Scheitern", das "Schweigen", das "Sprechen", die "Sprache" – das "Leben im Wartestand". Es fächert sich sofort ein nicht nur literarischer, sondern ein philosophischer Kosmos auf. Nun kann man aber im Spätwerk feststellen, wie Beckett seine Bildung versteckt. Im Frühwerk sprüht er vor Gelehrsamkeit, zitiert er als Erbe Joyce', setzt er sich mit Proust auseinander. Er will alles beweisen: mit Augustinus, mit Dante, mit Vico.
Das ist später auch noch alles da. Aber das Zitieren hat abgenommen. Es finden sich Andeutungen, Schemen, Schwingungen. Reduktion wird zum Prinzip. Die Spannung entsteht dadurch, dass er Augenblicke durch die Sprache endlos dehnt: die höchste Form der Kunst. Über Sprache, über Schweigen, über Pausen – über die Art, wie er Stimmen initiiert. Der Beckett'sche Ton bleibt dadurch unverwechselbar, den kann keiner kaputtkriegen: keine marode Theaterlandschaft, kein marktschreierischer Gestus. Warum? Weil er sich geschützt hat durch die Form. Darum ist er der Klassiker als Avantgardist geblieben – er steht eigentlich noch vor der Avantgarde. Letztere hat sich an seinen Experimenten eigentlich nur bedient.
Der Standard: Wobei "Avantgarde" ja ein Schimpfwort geworden ist. Man muss heute flüssig und süffig erzählen, möglichst so, wie es angelsächsische Romanciers zu tun pflegen.
Ria Endres: Es hat sich in der Rezeption einiges geändert. Darum hat sich Suhrkamp um Becketts Spätwerk auch so verdient gemacht. Siegfried Unseld hat ihm dadurch etwas zurückgegeben, weil Beckett ein Diadem war für sein Programm. Aber trotzdem: Das würde nicht jeder Verleger machen. Natürlich steht Becketts Werk durch die Veränderung des Kultur- und des Literaturbetriebs heute noch singulärer da. Er selbst hat sich gegen die "zeilenschinderische Vulgarität des realistischen Schreibens" deutlich ausgesprochen. Er wollte niemanden "unterhalten", sondern einen poetischen Raum in einer poetischen Form bewältigen. Daran hat er gearbeitet – und zwar sehr kompliziert. Daran ist er immer wieder gescheitert, denn Scheitern ist sein Thema. Heute? Darf ja niemand scheitern. Heute muss jeder Erfolg haben. Es gibt keinen langen Atem mehr, einen Autor wachsen zu lassen. Es wird keine Zeit mehr mitgegeben.
Beckett hatte jahrzehntelang winzige Auflagen, und er lebte sehr, sehr bescheiden. Er war überhaupt nicht darauf aus, im "Betrieb" mitzuwirken. Selbstverständlich ist er durch seine Pariser Bekanntschaft mit James Joyce auf interessante Menschen gestoßen. Er befand sich damals sozusagen im literarischen Zentrum der Welt. Natürlich bewegte er sich dorthin, wo er glaubte, dass Menschen seine Arbeit verstehen. Als er während des Krieges ins Roussillon aufs Land geflüchtet war, schrieb er völlig unverkäufliches Zeug. Watt oder Molloy sind keine Bücher, über die man sagt: "Die krieg ich schon los bei meinem Verleger!"
Hätte sich seine fabelhafte Lebensgefährtin nicht jahrelang die Hacken abgerannt für ihn in Paris, sähe es heute ganz anders aus. Es gäbe keinen Godot. Der war von rund 40 Theatern abgelehnt worden. Es besteht kein Grund, aus Beckett nachträglich einen Märtyrer zu machen. Aber es gehörte ein Glück dazu, das den besonderen Umständen der Nachkriegszeit geschuldet war: Es gab ganz einfach eine Aufmerksamkeit für das Karge, das Bilderlose. Es gab nachgerade eine Gier, eine neue literarische Welt aufzunehmen. Aber Becketts Ruhm hing eigentlich an einem seidenen Faden.
Der Standard: Als Beckett 1989 starb, reagierte die Öffentlichkeit eher verdutzt. Nach dem Motto: Was, er hat noch gelebt? Er spielte Schach im Altersheim, war höflich und bescheiden, bar aller Nobelpreisträger-Insignien.
Ria Endres: Er hat keinen Wert auf bürgerliche Behäbigkeit gelegt. Er hat sein Nobelpreisträger- Geld verschenkt, einen 2 CV gefahren, ein kleines Häuschen besessen. Warum hätte er als alter Mann plötzlich etwas anders machen sollen? Er hat kein tragisches Ende genommen, sondern sein Leben ist still verlöscht.
Der Standard: Beim Wiederlesen Ihrer Beckett-Essays stößt man auf die Sensibilität für Stimmen: Stimmen sind überall, sie "bewohnen" Becketts Helden. Wir leben heute in einer Mediokratie, die uns zahllosen Einflüsterungen aussetzt. Wäre dieser Blick auf die Alltagswelt ein Zeichen für eine mögliche Wiederentdeckung Becketts?
Ria Endres: Als Bilderschöpfer und Visionär bleibt Beckett einmalig im 20. Jahrhundert. Die Mülltonnen in Endspiel, Vinnie, die in Glückliche‑ Tage im Sand versinkt, wobei einem das Wort "Glück" im Hals stecken bleibt – die beiden Landstreicher in Warten auf Godot, die vor dem kargen Giacometti-Bäumchen ihr Dasein fristen: Wer denkt da nicht an Obdachlose, an Bettler? Das ist die moderne Welt. Nur wird sie von dieser Lüge überspült, in der wir ständig leben müssen. Die "freie Selbstentfaltung des Menschen" – die das nicht können oder nicht wollen, werden folgerichtig als Spielverderber angesehen. Darum ist Beckett vielleicht der größte Spielverderber von allen.
Der Standard: Wäre eine andere "Aktualität" nicht Becketts Insistenz auf das Elend des Alters? Immerhin sehen wir einer rapiden Vergreisung unserer Gesellschaft entgegen, während andererseits ein hedonistischer Jugendkult gepflegt wird. Wäre Beckett dann nicht so etwas wie die Flaschenpost für eine künftige Gesellschaft?
Ria Endres: Becketts Welt ist bevölkert von moribunden Gestalten, deren Alter nicht feststellbar ist. Aber der Tendenz nach, da haben Sie Recht, handelt es sich um Alte. Nur hat sich Beckett niemals vorgestellt: Wie beschreibe ich die Greisengesellschaft der Zukunft? Er ging anders vor: Er ist der Dichter des Zweiten Weltkriegs, er sah die Versehrten nach 1945 auf den Straßen von Paris. Es ist furchtbarer: Die menschliche Gestalt, das Gattungsbild löst sich bei ihm auf. Der Zustand der Geschlechter ist verheerend, das Patriarchat löst sich auf: Der Mann ist am Ende! Es gibt kein "männliches Genie" mehr. Er hat ein obszönes Werk hinterlassen, das auch den Frauen nichts schenkt. Der menschliche Körper kommt nicht mehr aus dem Endspielzimmer heraus. Der sekündliche, gedehnte Augenblick des Verfalls – das Kriechen über den Erdball – das Alleinsein als sprechende Kugel: Stimmen ziehen durch den Kopf, und Sie können sich nirgends festhalten. Das sekündliche Weiterschreiten in einen Endzustand hinein, der niemals zu Ende ist: Das ist die Hölle!
DER STANDARD, Printausgabe, Album vom 8.4.2006
Ria Endres: Schon vor rund 20 Jahren, aber auch früher, hing Becketts Ruhm am Theater. Die frühe Prosa, die Romantrilogie von Molloy, Malone stirbt und Der Namenlose, ganz zu schweigen vom Spätwerk – das war immer Literatur für wenige. Nehmen Sie Arbeiten wie Mal vu, mal dit: wunderbar gemachte Ausgaben bei Suhrkamp. Großartig übersetzt, dreisprachig, eine einzigartige Unternehmung in der Literatur der Welt! Das kommt meiner Vorstellung von literarischem Luxus sehr nahe.
Schon weil Beckett selbst zweisprachig war. Fast dreisprachig, weil er sehr gut Deutsch konnte und die Übersetzungen von Elmar Tophoven exaktest durchgesehen hat. Er hat ja obendrein seine Texte zurückübersetzt, vom Französischen ins Englische, und so weiter. Diese Präsentation des Spätwerks war für Leute, die zu lesen verstehen, ungeheuer bereichernd. Diese Chiffren der Welt, des Subjekts, wohin man kommt, wenn man im kosmischen Endspielzimmer sitzt, das konnte auf sehr beeindruckende Weise nachvollzogen werden.
Der Standard: Aber Beckett hatte doch seine theologischen Mucken. Im "Namenlosen" sitzt ein Kopf auf einer Urne und wird von Stimmen gehetzt. Der Stimme im Kopf entkommt der Mensch nicht. Aber das‑ geschundene Subjekt des Textes steuert auf ein Schweigen zu, das das "wahre" Schweigen wäre. Dergleichen gibt doch Rätsel auf?
Ria Endres: Ich glaube, darüber kann man nicht reden. Da würden wir noch in zehn Jahren dasitzen. Das ist ja das Verführerische und zugleich Komplizierte. Nehmen Sie irgendein Phänomen her: das "Ende", das "Glück", das "Scheitern", das "Schweigen", das "Sprechen", die "Sprache" – das "Leben im Wartestand". Es fächert sich sofort ein nicht nur literarischer, sondern ein philosophischer Kosmos auf. Nun kann man aber im Spätwerk feststellen, wie Beckett seine Bildung versteckt. Im Frühwerk sprüht er vor Gelehrsamkeit, zitiert er als Erbe Joyce', setzt er sich mit Proust auseinander. Er will alles beweisen: mit Augustinus, mit Dante, mit Vico.
Das ist später auch noch alles da. Aber das Zitieren hat abgenommen. Es finden sich Andeutungen, Schemen, Schwingungen. Reduktion wird zum Prinzip. Die Spannung entsteht dadurch, dass er Augenblicke durch die Sprache endlos dehnt: die höchste Form der Kunst. Über Sprache, über Schweigen, über Pausen – über die Art, wie er Stimmen initiiert. Der Beckett'sche Ton bleibt dadurch unverwechselbar, den kann keiner kaputtkriegen: keine marode Theaterlandschaft, kein marktschreierischer Gestus. Warum? Weil er sich geschützt hat durch die Form. Darum ist er der Klassiker als Avantgardist geblieben – er steht eigentlich noch vor der Avantgarde. Letztere hat sich an seinen Experimenten eigentlich nur bedient.
Der Standard: Wobei "Avantgarde" ja ein Schimpfwort geworden ist. Man muss heute flüssig und süffig erzählen, möglichst so, wie es angelsächsische Romanciers zu tun pflegen.
Ria Endres: Es hat sich in der Rezeption einiges geändert. Darum hat sich Suhrkamp um Becketts Spätwerk auch so verdient gemacht. Siegfried Unseld hat ihm dadurch etwas zurückgegeben, weil Beckett ein Diadem war für sein Programm. Aber trotzdem: Das würde nicht jeder Verleger machen. Natürlich steht Becketts Werk durch die Veränderung des Kultur- und des Literaturbetriebs heute noch singulärer da. Er selbst hat sich gegen die "zeilenschinderische Vulgarität des realistischen Schreibens" deutlich ausgesprochen. Er wollte niemanden "unterhalten", sondern einen poetischen Raum in einer poetischen Form bewältigen. Daran hat er gearbeitet – und zwar sehr kompliziert. Daran ist er immer wieder gescheitert, denn Scheitern ist sein Thema. Heute? Darf ja niemand scheitern. Heute muss jeder Erfolg haben. Es gibt keinen langen Atem mehr, einen Autor wachsen zu lassen. Es wird keine Zeit mehr mitgegeben.
Beckett hatte jahrzehntelang winzige Auflagen, und er lebte sehr, sehr bescheiden. Er war überhaupt nicht darauf aus, im "Betrieb" mitzuwirken. Selbstverständlich ist er durch seine Pariser Bekanntschaft mit James Joyce auf interessante Menschen gestoßen. Er befand sich damals sozusagen im literarischen Zentrum der Welt. Natürlich bewegte er sich dorthin, wo er glaubte, dass Menschen seine Arbeit verstehen. Als er während des Krieges ins Roussillon aufs Land geflüchtet war, schrieb er völlig unverkäufliches Zeug. Watt oder Molloy sind keine Bücher, über die man sagt: "Die krieg ich schon los bei meinem Verleger!"
Hätte sich seine fabelhafte Lebensgefährtin nicht jahrelang die Hacken abgerannt für ihn in Paris, sähe es heute ganz anders aus. Es gäbe keinen Godot. Der war von rund 40 Theatern abgelehnt worden. Es besteht kein Grund, aus Beckett nachträglich einen Märtyrer zu machen. Aber es gehörte ein Glück dazu, das den besonderen Umständen der Nachkriegszeit geschuldet war: Es gab ganz einfach eine Aufmerksamkeit für das Karge, das Bilderlose. Es gab nachgerade eine Gier, eine neue literarische Welt aufzunehmen. Aber Becketts Ruhm hing eigentlich an einem seidenen Faden.
Der Standard: Als Beckett 1989 starb, reagierte die Öffentlichkeit eher verdutzt. Nach dem Motto: Was, er hat noch gelebt? Er spielte Schach im Altersheim, war höflich und bescheiden, bar aller Nobelpreisträger-Insignien.
Ria Endres: Er hat keinen Wert auf bürgerliche Behäbigkeit gelegt. Er hat sein Nobelpreisträger- Geld verschenkt, einen 2 CV gefahren, ein kleines Häuschen besessen. Warum hätte er als alter Mann plötzlich etwas anders machen sollen? Er hat kein tragisches Ende genommen, sondern sein Leben ist still verlöscht.
Der Standard: Beim Wiederlesen Ihrer Beckett-Essays stößt man auf die Sensibilität für Stimmen: Stimmen sind überall, sie "bewohnen" Becketts Helden. Wir leben heute in einer Mediokratie, die uns zahllosen Einflüsterungen aussetzt. Wäre dieser Blick auf die Alltagswelt ein Zeichen für eine mögliche Wiederentdeckung Becketts?
Ria Endres: Als Bilderschöpfer und Visionär bleibt Beckett einmalig im 20. Jahrhundert. Die Mülltonnen in Endspiel, Vinnie, die in Glückliche‑ Tage im Sand versinkt, wobei einem das Wort "Glück" im Hals stecken bleibt – die beiden Landstreicher in Warten auf Godot, die vor dem kargen Giacometti-Bäumchen ihr Dasein fristen: Wer denkt da nicht an Obdachlose, an Bettler? Das ist die moderne Welt. Nur wird sie von dieser Lüge überspült, in der wir ständig leben müssen. Die "freie Selbstentfaltung des Menschen" – die das nicht können oder nicht wollen, werden folgerichtig als Spielverderber angesehen. Darum ist Beckett vielleicht der größte Spielverderber von allen.
Der Standard: Wäre eine andere "Aktualität" nicht Becketts Insistenz auf das Elend des Alters? Immerhin sehen wir einer rapiden Vergreisung unserer Gesellschaft entgegen, während andererseits ein hedonistischer Jugendkult gepflegt wird. Wäre Beckett dann nicht so etwas wie die Flaschenpost für eine künftige Gesellschaft?
Ria Endres: Becketts Welt ist bevölkert von moribunden Gestalten, deren Alter nicht feststellbar ist. Aber der Tendenz nach, da haben Sie Recht, handelt es sich um Alte. Nur hat sich Beckett niemals vorgestellt: Wie beschreibe ich die Greisengesellschaft der Zukunft? Er ging anders vor: Er ist der Dichter des Zweiten Weltkriegs, er sah die Versehrten nach 1945 auf den Straßen von Paris. Es ist furchtbarer: Die menschliche Gestalt, das Gattungsbild löst sich bei ihm auf. Der Zustand der Geschlechter ist verheerend, das Patriarchat löst sich auf: Der Mann ist am Ende! Es gibt kein "männliches Genie" mehr. Er hat ein obszönes Werk hinterlassen, das auch den Frauen nichts schenkt. Der menschliche Körper kommt nicht mehr aus dem Endspielzimmer heraus. Der sekündliche, gedehnte Augenblick des Verfalls – das Kriechen über den Erdball – das Alleinsein als sprechende Kugel: Stimmen ziehen durch den Kopf, und Sie können sich nirgends festhalten. Das sekündliche Weiterschreiten in einen Endzustand hinein, der niemals zu Ende ist: Das ist die Hölle!
DER STANDARD, Printausgabe, Album vom 8.4.2006