DIGITALES PROGRAMMHEFT
INTERVIEW MIT DER DRAMATIKERIN CAREN JEß
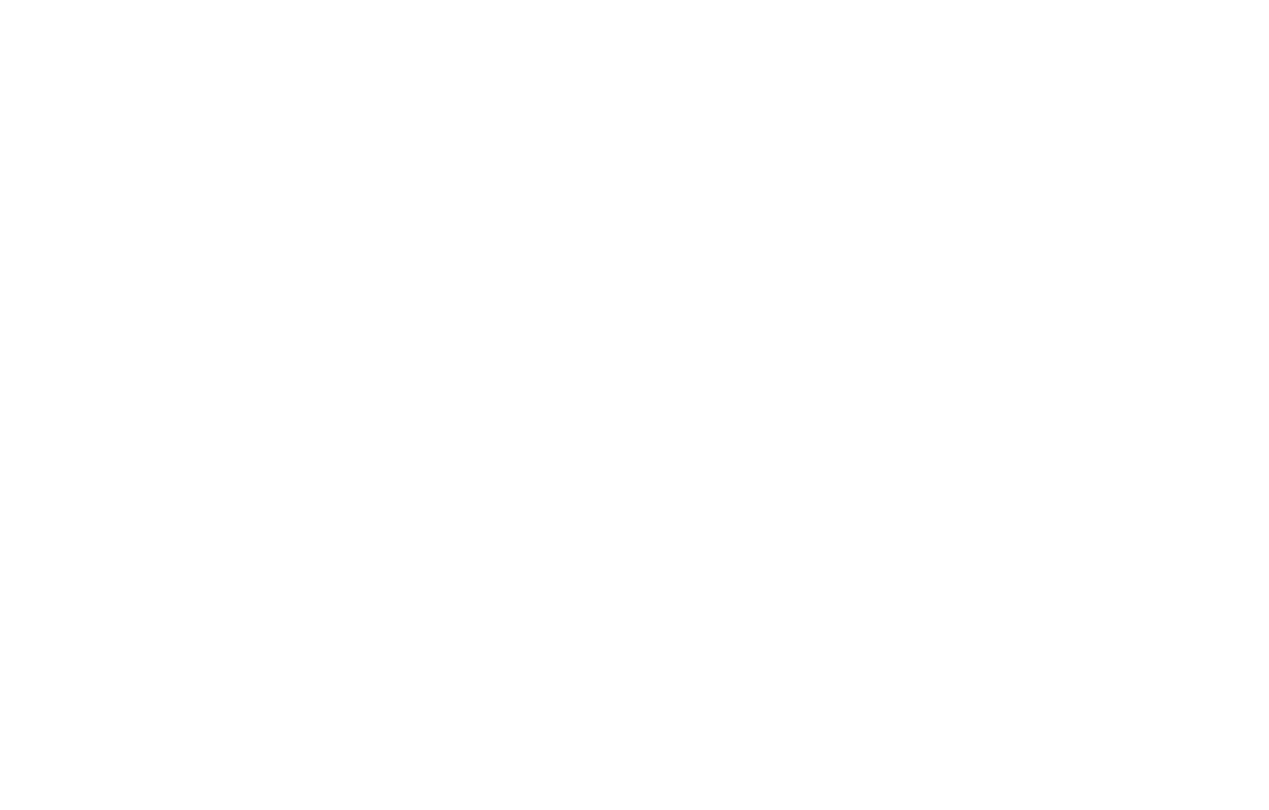
© Jewgeni Roppel
Viele Ihrer Theaterstücke überraschen durch ungewöhnliche Konstellationen. Da bevölkern in „Bookpink“ zahlreiche Vögel die Szene, in „Das Stillleben“ wird ein Gemälde Anlass für eine heftige Auseinandersetzung, in „Die Katze Eleonore“ will eine Immobilienmaklerin als Katze leben oder in „To my little boy“ findet ein 40jähriger Geologe einzig in seinem Plüschschwein wirklich Halt. Wie kommen Sie auf solche Grundideen?
Caren Jeß: Mein Interesse ist geweckt, wenn etwas besonders deutlich von der Norm abweicht. Vielleicht weil sich dadurch das breite Spektrum des Menschseins zeigt und verfestigte Strukturen wieder beweglich erscheinen.
Ihr Schreiben verknüpft sich immer mit brisanten, auch schmerzhaften gesellschaftlichen Themen. Was treibt Sie ganz aktuell besonders um?
Caren Jeß: König Ludwig II. und sein Schloss Neuschwanstein. Ein megalomaner König, dem die Flucht vor der Gesellschaft in eine märchenhafte Welt mithilfe der Ausbeutung ebenjener Gesellschaft gelingt. Quasi Menschen für sich arbeiten zu lassen, um sie loszuwerden. Das finde ich gerade spannend und in Hinblick auf gegenwärtige Machtträger hochaktuell.
Wie wichtig ist Ihnen Humor - beim Schreiben und überhaupt?
Caren Jeß: Humor schreibt sich unweigerlich in meine Texte ein. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, in der ständig Anekdoten erzählt wurden, besonders mein Großvater und meine Brüder erzählten Geschichten vom Bauernhof und vom Bau. Mir ist erst später aufgefallen, dass es nicht an jedem Küchentisch so ist, dass erstmal eine unterhaltsame Geschichte zum Besten gegeben wird, bevor das Essen serviert wird. Mir ist ebenfalls erst später aufgefallen, dass diese Entertainer meistens männlich waren (ich denke auch an den Klassenclown in der Schule). Hier stemme ich mich gegen den Standard. Wir brauchen alle Humor. Ich verstehe Humor nicht unbedingt als Gegenteil von Ernsthaftigkeit, sondern von Hoffnungslosigkeit.
Sara und Ann im Stück „Heartship“ sind zwei sehr nahbare Menschen, selbstbewusste Frauen, beruflich erfolgreich – und doch sind beide Alleinkämpferinnen …
Caren Jeß: Aber sie bleiben es nicht! „Wir sollten uns zusammenschmeißen!“, sagt Sara zu Ann, und das machen sie ja dann auch. Und ich hoffe, dass sie über ihre eigene Verbindung hinaus noch viele weitere Heartships stiften!
Wie gehen beide jeweils mit ihrem biografischen (traumatischen) „Gepäck“ um?
Caren Jeß: Als Ärztin begegnet Ann ihren Problemen analytisch. Sara ist extrovertiert und kennt kein Pardon, Unangenehmes direkt und emotional anzusprechen. Problematische Themen, die sie persönlich betreffen, scheint sie aber zu unterdrücken. Obwohl sie vom Temperament her stärker wirkt, expressiver und konfrontativer, ist die introvertierte Ann am Ende vielleicht aber stärker darin, persönliches Leid zu thematisieren. Sie ergänzen sich in ihrer Unterschiedlichkeit und demonstrieren damit auch implizit, dass man nicht dem Irrtum erliegen sollte, Probleme allein in den Griff kriegen zu müssen.
Sara vertritt in ihrer Show mit kreativer Wut, wilder sprachlicher Lust und viel Humor feministische Perspektiven. Sind „die Männer“ der Feind?
Caren Jeß: Nein, das wäre zu einfach. Es macht ihr ungeheuren Spaß, sich über bestimmte männliche Verhaltensweisen lustig zu machen. Spaß ist hier wirklich die wichtigere Vokabel als Hass. Tendenziell nehmen sich Frauen häufig zurück, werden früh mit Carework betraut, lernen, sich zu kümmern, verständnisvoll und nachgiebig zu sein. Aber Frauen dürfen unbedingt auch mal die Sau rauslassen! Und wenn Sara dabei hier und da etwas zotiger wird, sollte ihr energischer, provokanter Enthusiasmus da nicht in jedem Detail für bare Münze genommen werden. Am Ende kann der Kampf um Gleichberechtigung nur ein solidarischer und geschlechterübergreifender sein. Das weiß auch Sara. Aber statt diese Erkenntnis nachsichtig abzunicken, gibt sie uns halt lieber ein paar saftige Stand-Up-Performances. Weil sie sich wünscht, ihr Publikum zum Lachen zu bringen, statt sich im kollektiven Frust über den Status Quo zu spiegeln.
Was führt die beiden Frauen zusammen?
Caren Jeß: Ihre Wut und ihr inniges Bedürfnis, sich verstanden zu fühlen.
Worin liegt das Besondere der entstehenden Beziehung, die sie „Heartship“ nennen?
Caren Jeß Ein Heartship ist eine tiefe, liebevolle Verbindung jenseits konventioneller Beziehungsgrenzen. Das Besondere dabei ist, dass ein Heartship jeweils individuell definiert werden kann, eben als das ganz eigene Heartshipgefühl, das du mit einem bestimmten Menschen teilst. Sara und Ann kennzeichnen ein Heartship als „absolute Metapher“. Eine absolute Metapher ist in der Literaturwissenschaft eine Metapher, die sich nicht klar interpretieren lässt, sondern die Raum für eigene Assoziationen und Gefühle lässt. So gleicht kein Heartship dem anderen.
„Zieht euch die Zuschreibungen vom Leib wie Pflaster!“ – habe ich in einem anderen Stück von Ihnen gelesen. Das trifft auf die beiden Protagonistinnen hier ebenso zu, oder?
Caren Jeß: Ja! Auch in Bezug auf Feminismus übrigens. Denn der Kampf um Gleichberechtigung stellt nicht die Bedingung, sich etwa eines gleichen Vokabulars oder ähnlicher gesellschaftlicher Codes zu bedienen. Sara gendert beispielsweise, während Ann das nicht tut. Dennoch verbindet beide die gleiche Wut über mangelnde Gleichberechtigung. Und darum geht es, um ein gemeinsames Erleben, nicht um irgendwelche Labels oder Markierungen, die eine Annäherung erschweren.
In Anns Leben gibt es einen jungen Mann: ihren Sohn Lauri, mit dem sie im Stück telefoniert. Könnte er ein Mann der nächsten Generation sein, einer, der patriarchale Muster und Strukturen nicht mehr leben wird?
Caren Jeß: Auf jeden Fall. Lauri ist die Hoffnung! Wir erfahren wenig über ihn, können aber davon ausgehen, dass er ein sensibler, aufmerksamer Mensch mit Interesse an Politik, Literatur und Sinéad O’Connor ist. Letzteres hat sich zufällig ins Stück eingeschrieben, berührt mich an dieser Figur aber besonders. Er verehrt eine Musikerin, die sich als Feministin behauptet hat und mit traumatischer Belastung durch sexuelle Gewalt gekämpft hat, ohne zu wissen, dass seine eigene Mutter ähnliche Erfahrungen gemacht hat.
Wen möchten Sie mit Ihrem Stück „Heartship“ erreichen?
Caren Jeß: Alle, die mehr vom Leben wollen als einen Zaun um ihr Vater-Mutter-Kind-Konzept.
Ist es auch ein Akt des Empowerment?
Caren Jeß: Heartship steht für den Mut und die Lust, sich gemeinsam gegen Gewalt und Benachteiligung zu stellen. Und dabei auch noch Spaß zu haben.
Würden Sie sich selbst als Feministin oder feministische Dramatikerin bezeichnen?
Caren Jeß: Unbedingt! Feminismus ist für mich zunächst kein Kampfbegriff, sondern eine Selbstverständlichkeit. Wir wissen alle, dass Frauen bzw. FLINTAs aufgrund ihrer geschlechtlichen Identität in unserer patriarchalen Gesellschaft benachteiligt sind, was gesamtgesellschaftlichen Schaden bewirkt. Ein Wort dieser Aussage, das ich hervorheben möchte: Schaden. Feminismus setzt sich für dessen Behebung ein. Und da bin ich dabei. Ähnlich wie Sara es beschreibt, war ich aber nicht immer schon Feministin. Als Kind wollte ich sogar lieber ein Junge sein. Die sind auf Bäume geklettert, lachend über den Hof gefetzt und haben auf die Mädchen „aufgepasst“. Und zur Gruppe der Schwächeren wollte ich halt nicht gehören. Heute ist für mich sinnstiftend, eben diese Gruppe von innen zu stärken.
Interview: Bettina Jantzen; September 2025
Caren Jeß: Mein Interesse ist geweckt, wenn etwas besonders deutlich von der Norm abweicht. Vielleicht weil sich dadurch das breite Spektrum des Menschseins zeigt und verfestigte Strukturen wieder beweglich erscheinen.
Ihr Schreiben verknüpft sich immer mit brisanten, auch schmerzhaften gesellschaftlichen Themen. Was treibt Sie ganz aktuell besonders um?
Caren Jeß: König Ludwig II. und sein Schloss Neuschwanstein. Ein megalomaner König, dem die Flucht vor der Gesellschaft in eine märchenhafte Welt mithilfe der Ausbeutung ebenjener Gesellschaft gelingt. Quasi Menschen für sich arbeiten zu lassen, um sie loszuwerden. Das finde ich gerade spannend und in Hinblick auf gegenwärtige Machtträger hochaktuell.
Wie wichtig ist Ihnen Humor - beim Schreiben und überhaupt?
Caren Jeß: Humor schreibt sich unweigerlich in meine Texte ein. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, in der ständig Anekdoten erzählt wurden, besonders mein Großvater und meine Brüder erzählten Geschichten vom Bauernhof und vom Bau. Mir ist erst später aufgefallen, dass es nicht an jedem Küchentisch so ist, dass erstmal eine unterhaltsame Geschichte zum Besten gegeben wird, bevor das Essen serviert wird. Mir ist ebenfalls erst später aufgefallen, dass diese Entertainer meistens männlich waren (ich denke auch an den Klassenclown in der Schule). Hier stemme ich mich gegen den Standard. Wir brauchen alle Humor. Ich verstehe Humor nicht unbedingt als Gegenteil von Ernsthaftigkeit, sondern von Hoffnungslosigkeit.
Sara und Ann im Stück „Heartship“ sind zwei sehr nahbare Menschen, selbstbewusste Frauen, beruflich erfolgreich – und doch sind beide Alleinkämpferinnen …
Caren Jeß: Aber sie bleiben es nicht! „Wir sollten uns zusammenschmeißen!“, sagt Sara zu Ann, und das machen sie ja dann auch. Und ich hoffe, dass sie über ihre eigene Verbindung hinaus noch viele weitere Heartships stiften!
Wie gehen beide jeweils mit ihrem biografischen (traumatischen) „Gepäck“ um?
Caren Jeß: Als Ärztin begegnet Ann ihren Problemen analytisch. Sara ist extrovertiert und kennt kein Pardon, Unangenehmes direkt und emotional anzusprechen. Problematische Themen, die sie persönlich betreffen, scheint sie aber zu unterdrücken. Obwohl sie vom Temperament her stärker wirkt, expressiver und konfrontativer, ist die introvertierte Ann am Ende vielleicht aber stärker darin, persönliches Leid zu thematisieren. Sie ergänzen sich in ihrer Unterschiedlichkeit und demonstrieren damit auch implizit, dass man nicht dem Irrtum erliegen sollte, Probleme allein in den Griff kriegen zu müssen.
Sara vertritt in ihrer Show mit kreativer Wut, wilder sprachlicher Lust und viel Humor feministische Perspektiven. Sind „die Männer“ der Feind?
Caren Jeß: Nein, das wäre zu einfach. Es macht ihr ungeheuren Spaß, sich über bestimmte männliche Verhaltensweisen lustig zu machen. Spaß ist hier wirklich die wichtigere Vokabel als Hass. Tendenziell nehmen sich Frauen häufig zurück, werden früh mit Carework betraut, lernen, sich zu kümmern, verständnisvoll und nachgiebig zu sein. Aber Frauen dürfen unbedingt auch mal die Sau rauslassen! Und wenn Sara dabei hier und da etwas zotiger wird, sollte ihr energischer, provokanter Enthusiasmus da nicht in jedem Detail für bare Münze genommen werden. Am Ende kann der Kampf um Gleichberechtigung nur ein solidarischer und geschlechterübergreifender sein. Das weiß auch Sara. Aber statt diese Erkenntnis nachsichtig abzunicken, gibt sie uns halt lieber ein paar saftige Stand-Up-Performances. Weil sie sich wünscht, ihr Publikum zum Lachen zu bringen, statt sich im kollektiven Frust über den Status Quo zu spiegeln.
Was führt die beiden Frauen zusammen?
Caren Jeß: Ihre Wut und ihr inniges Bedürfnis, sich verstanden zu fühlen.
Worin liegt das Besondere der entstehenden Beziehung, die sie „Heartship“ nennen?
Caren Jeß Ein Heartship ist eine tiefe, liebevolle Verbindung jenseits konventioneller Beziehungsgrenzen. Das Besondere dabei ist, dass ein Heartship jeweils individuell definiert werden kann, eben als das ganz eigene Heartshipgefühl, das du mit einem bestimmten Menschen teilst. Sara und Ann kennzeichnen ein Heartship als „absolute Metapher“. Eine absolute Metapher ist in der Literaturwissenschaft eine Metapher, die sich nicht klar interpretieren lässt, sondern die Raum für eigene Assoziationen und Gefühle lässt. So gleicht kein Heartship dem anderen.
„Zieht euch die Zuschreibungen vom Leib wie Pflaster!“ – habe ich in einem anderen Stück von Ihnen gelesen. Das trifft auf die beiden Protagonistinnen hier ebenso zu, oder?
Caren Jeß: Ja! Auch in Bezug auf Feminismus übrigens. Denn der Kampf um Gleichberechtigung stellt nicht die Bedingung, sich etwa eines gleichen Vokabulars oder ähnlicher gesellschaftlicher Codes zu bedienen. Sara gendert beispielsweise, während Ann das nicht tut. Dennoch verbindet beide die gleiche Wut über mangelnde Gleichberechtigung. Und darum geht es, um ein gemeinsames Erleben, nicht um irgendwelche Labels oder Markierungen, die eine Annäherung erschweren.
In Anns Leben gibt es einen jungen Mann: ihren Sohn Lauri, mit dem sie im Stück telefoniert. Könnte er ein Mann der nächsten Generation sein, einer, der patriarchale Muster und Strukturen nicht mehr leben wird?
Caren Jeß: Auf jeden Fall. Lauri ist die Hoffnung! Wir erfahren wenig über ihn, können aber davon ausgehen, dass er ein sensibler, aufmerksamer Mensch mit Interesse an Politik, Literatur und Sinéad O’Connor ist. Letzteres hat sich zufällig ins Stück eingeschrieben, berührt mich an dieser Figur aber besonders. Er verehrt eine Musikerin, die sich als Feministin behauptet hat und mit traumatischer Belastung durch sexuelle Gewalt gekämpft hat, ohne zu wissen, dass seine eigene Mutter ähnliche Erfahrungen gemacht hat.
Wen möchten Sie mit Ihrem Stück „Heartship“ erreichen?
Caren Jeß: Alle, die mehr vom Leben wollen als einen Zaun um ihr Vater-Mutter-Kind-Konzept.
Ist es auch ein Akt des Empowerment?
Caren Jeß: Heartship steht für den Mut und die Lust, sich gemeinsam gegen Gewalt und Benachteiligung zu stellen. Und dabei auch noch Spaß zu haben.
Würden Sie sich selbst als Feministin oder feministische Dramatikerin bezeichnen?
Caren Jeß: Unbedingt! Feminismus ist für mich zunächst kein Kampfbegriff, sondern eine Selbstverständlichkeit. Wir wissen alle, dass Frauen bzw. FLINTAs aufgrund ihrer geschlechtlichen Identität in unserer patriarchalen Gesellschaft benachteiligt sind, was gesamtgesellschaftlichen Schaden bewirkt. Ein Wort dieser Aussage, das ich hervorheben möchte: Schaden. Feminismus setzt sich für dessen Behebung ein. Und da bin ich dabei. Ähnlich wie Sara es beschreibt, war ich aber nicht immer schon Feministin. Als Kind wollte ich sogar lieber ein Junge sein. Die sind auf Bäume geklettert, lachend über den Hof gefetzt und haben auf die Mädchen „aufgepasst“. Und zur Gruppe der Schwächeren wollte ich halt nicht gehören. Heute ist für mich sinnstiftend, eben diese Gruppe von innen zu stärken.
Interview: Bettina Jantzen; September 2025
REGISSEURIN LILLI-HANNAH HOEPNER IM GESPRÄCH
Was interessiert dich am Zusammentreffen dieser zwei so unterschiedlichen Frauen?
Es ist schön, wie die beiden, die aus ihrer Geschichte heraus in der Welt ziemlich alleine dastehen, sich so offen begegnen. Jede kann so sein, wie sie ist. Verurteilung gibt es nicht. Das ist kostbar und ein Ausgangspunkt für viel Gutes.
Wie gelingt es, dass Ann und Sara aneinander wachsen?
Ann ist introvertiert, Sara hingegen extrovertiert. Für beide sind das jeweils Fluchtmöglichkeiten. Sara hat immer einen flotten Spruch auf den Lippen, aber erzählt wenig von sich selbst. Sie öffnet sich aber immer mehr, weil Ann die richtigen Fragen stellt. Andersherum ist die lustige und zupackende Sara für Ann sehr wertvoll, um aus ihrer Isolation herauszukommen und zu lernen, sich zu artikulieren und Raum zu nehmen.
Die Geschichte zeigt, dass erlebte sexualisierte Gewalt traumatisch wirken kann ...
Statistiken belegen, dass sehr viele Frauen sexualisierte Gewalt erfahren. Meist sieht man es ihnen aber nicht an. Sie haben gelernt zu funktionieren, sind auf den ersten Blick keine psychisch geschädigten Opfer. Und doch sind sie mit ihren Erfahrungen oft ganz allein. Im Stück wird deutlich, wie es ist, durch ein traumatisches Erlebnis in eine Art Paralleluniversum geschleudert zu werden. Man lebt weiter, als ob alles normal wäre, macht Karriere, hat Familie ... Aber da ist immer das Gefühl, nicht wirklich zu leben, nur so zu tun als ob. Das ist Anns Situation. Und dann streckt Sara aus dem „echten Leben“ eine Hand rüber und Ann spürt, es gibt doch Wege, wieder ein lebendiger Teil der Gesellschaft zu werden.
Sind Sara und Ann Feministinnen?
Sara würde sich selbst als Feministin bezeichnen, Ann wahrscheinlich nicht. Ich denke aber, ja, beide sind Feministinnen. Für mich ist Feminismus kein Kampfbegriff. Es geht nicht um Ausgrenzung von Männern, nicht um Männerhass. Jede und jeder, die oder der für eine gleichberechtigte Teilhabe von Frauen an der Gesellschaft ist, ist für mich Feminist*in.
Wofür steht das Motiv des „Drucks“, das auf vielfältige Weise vorkommt?
Viele Menschen stehen heute unter enormem Druck. Es gibt hohe Erwartungen an alle. Selbstoptimierung und immer größere Produktivität werden verlangt. Und dabei ist die Sorge präsent, abgehängt zu werden … All dem muss man Stand halten, um zu überleben und „erfolgreich“ zu sein. Druck kann einen positiven Effekt haben, man „pusht sich“ weiter und kann Dinge erreichen, aber wenn zu viel Druck da ist, braucht es ein Ventil, sonst geht etwas kaputt. So können psychische Erkrankungen entstehen, wie zum Beispiel die Dermatillomanie bei Ann. Diese ist ein Ventil für Druck. Aber auch Saras provokante Reden im „Heartship“ sind ein Ventil.
Warum hast du einen weiteren Akteur in deine Inszenierung eingebunden?
Der Text an sich ist schon sehr musikalisch und rhythmisch, und ich hatte Lust, dem weiter nachzugehen. Es eröffnen sich noch mal neue, sinnliche Welten. Besonders die elektronische Musik, für die wir uns entschieden haben – Klänge aus Synthesizern, die in jedem Moment neu entstehen – bringt etwas Lebendiges und Unvorhersehbares mit sich. Und ich mag, dass die Geschichte der zwei Frauen nicht nur von ihnen selbst erzählt wird, sondern auch von einem Mann mitgetragen wird. In seiner Präsenz liegt etwas Irritierendes und zugleich Tröstliches, denn das vermeintlich Störende, das „Andere“, wird zum Teil des Ganzen. So wird er Anwalt und Unterstützer der Belange der Frauen. Mit einer fast nebensächlichen Selbstverständlichkeit signalisiert er: Das geht alle an. Ein berührendes und wichtiges Bild, finde ich.
Interview: Bettina Jantzen
Es ist schön, wie die beiden, die aus ihrer Geschichte heraus in der Welt ziemlich alleine dastehen, sich so offen begegnen. Jede kann so sein, wie sie ist. Verurteilung gibt es nicht. Das ist kostbar und ein Ausgangspunkt für viel Gutes.
Wie gelingt es, dass Ann und Sara aneinander wachsen?
Ann ist introvertiert, Sara hingegen extrovertiert. Für beide sind das jeweils Fluchtmöglichkeiten. Sara hat immer einen flotten Spruch auf den Lippen, aber erzählt wenig von sich selbst. Sie öffnet sich aber immer mehr, weil Ann die richtigen Fragen stellt. Andersherum ist die lustige und zupackende Sara für Ann sehr wertvoll, um aus ihrer Isolation herauszukommen und zu lernen, sich zu artikulieren und Raum zu nehmen.
Die Geschichte zeigt, dass erlebte sexualisierte Gewalt traumatisch wirken kann ...
Statistiken belegen, dass sehr viele Frauen sexualisierte Gewalt erfahren. Meist sieht man es ihnen aber nicht an. Sie haben gelernt zu funktionieren, sind auf den ersten Blick keine psychisch geschädigten Opfer. Und doch sind sie mit ihren Erfahrungen oft ganz allein. Im Stück wird deutlich, wie es ist, durch ein traumatisches Erlebnis in eine Art Paralleluniversum geschleudert zu werden. Man lebt weiter, als ob alles normal wäre, macht Karriere, hat Familie ... Aber da ist immer das Gefühl, nicht wirklich zu leben, nur so zu tun als ob. Das ist Anns Situation. Und dann streckt Sara aus dem „echten Leben“ eine Hand rüber und Ann spürt, es gibt doch Wege, wieder ein lebendiger Teil der Gesellschaft zu werden.
Sind Sara und Ann Feministinnen?
Sara würde sich selbst als Feministin bezeichnen, Ann wahrscheinlich nicht. Ich denke aber, ja, beide sind Feministinnen. Für mich ist Feminismus kein Kampfbegriff. Es geht nicht um Ausgrenzung von Männern, nicht um Männerhass. Jede und jeder, die oder der für eine gleichberechtigte Teilhabe von Frauen an der Gesellschaft ist, ist für mich Feminist*in.
Wofür steht das Motiv des „Drucks“, das auf vielfältige Weise vorkommt?
Viele Menschen stehen heute unter enormem Druck. Es gibt hohe Erwartungen an alle. Selbstoptimierung und immer größere Produktivität werden verlangt. Und dabei ist die Sorge präsent, abgehängt zu werden … All dem muss man Stand halten, um zu überleben und „erfolgreich“ zu sein. Druck kann einen positiven Effekt haben, man „pusht sich“ weiter und kann Dinge erreichen, aber wenn zu viel Druck da ist, braucht es ein Ventil, sonst geht etwas kaputt. So können psychische Erkrankungen entstehen, wie zum Beispiel die Dermatillomanie bei Ann. Diese ist ein Ventil für Druck. Aber auch Saras provokante Reden im „Heartship“ sind ein Ventil.
Warum hast du einen weiteren Akteur in deine Inszenierung eingebunden?
Der Text an sich ist schon sehr musikalisch und rhythmisch, und ich hatte Lust, dem weiter nachzugehen. Es eröffnen sich noch mal neue, sinnliche Welten. Besonders die elektronische Musik, für die wir uns entschieden haben – Klänge aus Synthesizern, die in jedem Moment neu entstehen – bringt etwas Lebendiges und Unvorhersehbares mit sich. Und ich mag, dass die Geschichte der zwei Frauen nicht nur von ihnen selbst erzählt wird, sondern auch von einem Mann mitgetragen wird. In seiner Präsenz liegt etwas Irritierendes und zugleich Tröstliches, denn das vermeintlich Störende, das „Andere“, wird zum Teil des Ganzen. So wird er Anwalt und Unterstützer der Belange der Frauen. Mit einer fast nebensächlichen Selbstverständlichkeit signalisiert er: Das geht alle an. Ein berührendes und wichtiges Bild, finde ich.
Interview: Bettina Jantzen
WEITERFÜHRENDE LINKS
Sexualisierte Gewalt ist in unserer Gesellschaft weit verbreitet. Sie beginnt bereits bei jeder Form unerwünschter sexueller Kommunikation.
Hilfe bei sexualisierter Gewalt finden Sie
Dermatillomanie – auch als „Skin-Picking-Disorder“ bezeichnet – ist ein Ventil für negative Gefühlszustände.
PMDS (Prämenstruelle Dysphorische Störung) – Informationen und Hilfe finden Sie